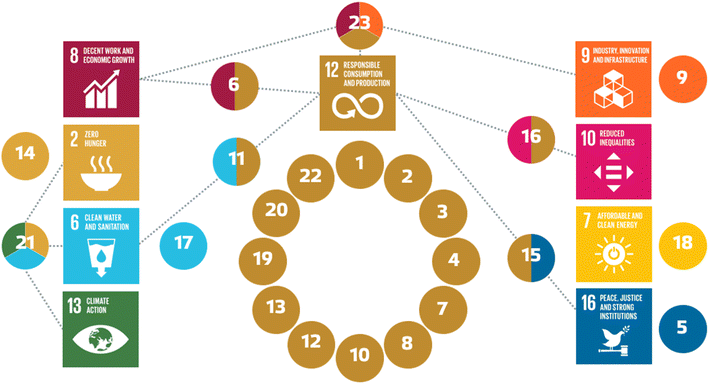Europe After 2030 – The Development of Waste Management into an Industrial Location Factor (ARC, 19.11.2025)
5. November 2025
Prof. Dr. Uwe Lahl wird auf der Advanced Recycling Conference am 19.11.2025 in Köln in seinem Vortrag „Europe After 2030 – The Development of Waste Management into an Industrial Location Factor“ vorstellen, welchen Beitrag die Kreislaufwirtschaft zur Defossilisiserung des Rohstoffeinsatzes der Chemischen Industrie liefern kann. Der Beitrag ist ein Update einer Veröffentlichung in Müll und Abfall 5, 2025.
Kritisch bei der Defossilisierung der Industrie ist die Fokussierung der Gesetzgebung in Brüssel zu sehen, die einerseits viel zu stark auf den Wasserstoffpfad setzt und gleichzeitig Erstinvestitionen in den Aufbau von Infrastrukturen überreguliert. Auch in Deutschland wurde in der Vergangenheit einseitig auf finanzielle Förderungen einzelner Transformations-Projekte gesetzt (Capex-Förderungen). Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass es politisch zwar einfacher ist, diese Förderungen umzusetzen. Dies reicht aber nicht aus, weil zusätzlich auch die Randbedingungen geschaffen werden müssen, damit die defossilisierten Produkte wettbewerbsfähig sind und dann auch gekauft werden. Bei der notwendigen Regulierung ist vielmehr ein kluger Policy Mix gefordert, der einerseits verbindliche Ziele auf Ebene der einzelnen Unternehmen setzt, der andererseits aber auch die Schaffung von zuverlässigen Märkten für defossilisierte Produkte fördert.
Weitere Einzlheiten sind auf der Webseite der Veranstaltung zu finden.